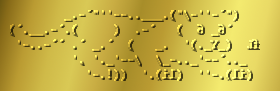Sonntag, 01. August 2021
Ein letztes umfangreiches Frühstück. Am Parkplatz trifft mich dann allerdings der Schlag. Das Auto ist total eingesaut. Überreste von Affen und Vögeln, die in den Bäumen über dem Parkplatz leben. Das Auto sieht wirklich schlimm aus. Daher mache ich nach Abfahrt einen kurzen Halt an der Tankstelle von Kasane. Ich bitte den Tankwart, wenigstens meine Windschutzscheibe sauber zu machen.

Dann geht die Fahrt auf der A33 zunächst Richtung Ngoma Grenzposten. Es geht endlos gerade. Man erahnt die entgegenkommenden Autos bereits 15 Minuten, bevor man sich dann begegnet. Auf der Straße hinter mir bilden sich tolle Fata Morganen. Kurz vor dem Grenzposten kommt die gut beschilderte Abzweigung auf die B334 Richtung Linyanti. Die Durchquerung des Chobe Forest Reserves geht problemlos, ist ja auch alles Asphaltstraße. Auf der kurvenreichen, aber schönen Strecke kommt man der Grenze zwischen Botswana und Namibia auf nur wenige Meter sehr nahe. Die Strecke läuft am Chobe Fluss entlang, und die Grenze verläuft in der Flussmitte. Nach etwa 95 km erreiche ich die Ortschaft Kachikau. Dort endet die Asphaltstraße und geht in die mir schon bekannte circa 40 km lange Sandpiste Richtung Ghoha North Gate über.

Ich befinde mich nun mitten im Kalahari-Becken. Das Kalahari-Becken ist die größte durchgehende Sandausdehnung auf unserem Planeten. Der Schichtenaufbau wird in der Geologie sogar als Kalahari-System bezeichnet. Das gewaltige Sedimentbecken von über 2,5 Millionen km² (sieben mal die Fläche von Deutschland) geht vom Gariep oder Oranje Fluss in Südafrika aus nordwärts über das östliche Namibia, umfasst beinahe das gesamte Botswana, den Westen von Zimbabwe und reicht tief nach Angola und Sambia hinein mit Ausläufern bis nach Gabun und die Demokratische Republik Kongo. Beim ersten Blick ähnelt das Gebiet nur wenig dem üblichen Klischee, das mit dem Wort Sandwüste verbunden wird. Aber die sandigen und hochporösen Böden, mit einer Mächtigkeit bis zu 200 Metern, ermöglichen nur dünne Vegetation, da Regenfälle nur sporadisch sind, die Sommer brütend heiß, und es eine beinahe totale Abwesenheit von Oberflächenwasser gibt.
Die Sandmengen entstanden durch Erosion von Sandsteinen der geologischen Formationen der Kalahari Group und der Karoo Supergroup. Diese umfassen eine über 100 Millionen Jahre entstandene Sedimentabfolge. Die Mächtigkeit der Ablagerungen und Sandsteine übersteigt in einigen Gegenden 10.000 Meter. Während der Eiszeiten, die letzte endete vor circa 10.000 Jahren, entstanden im südlichen Afrika aride Konditionen. Regen im Inneren wurde weniger, die Vegetation wurde dünner, und eine gewaltige Wüste entstand im Zentrum. Der Sand dieser früheren Wüste bildet das Kalahari-Becken. Noch während der Eiszeiten wurden die Sandmassen vom Wind verschoben und zu Dünensystemen geformt, die einige zehn bis hunderte Kilometer lang sind und meistens parallel zueinander verlaufen. Die Kräfte von Wind und Wasser formten in der Kalahari schließlich die zufälligen Ebenen, Dünen und Pfannen.
Erst in der jüngsten Erdgeschichte, vor etwa 10.000 bis 20.000 Jahren, wurden die Sanddünen durch Pflanzenbewuchs stabilisiert, so dass heute eine Trockensavanne die Landschaft prägt. Die Mehrheit der Dünen wandert also nicht, wie etwa in der Namib-Wüste. Es herrschen Gräser, Dornensträucher und Akazienbäume vor, die die langen Trockenperioden von rund zehn Monaten in guten Jahren überstehen können. Aufgrund dieses Pflanzenbewuchses nehmen wir die gewaltige Ausdehnung von Wüstensand im Kalahari-Becken nicht mehr wahr. Dennoch ist und bleibt es Wüstensand. In vielen Regionen ist der Sand weiß bis cremefarben. Aber in einigen Gegenden liegt die Farbe im roten Bereich des Farbspektrums von blassem Pink über Ocker bis zu intensivem Rot-orange. Die rote Farbe kommt von einer extrem dünnen Schicht von Eisenoxid auf den Sandkörnern.

Es hat 28 °C, und die Sonne brennt vom nur leicht bewölkten Himmel. Kaum habe ich die Asphaltstraße verlassen, beginnt nur 200 Meter danach eine sehr schwere Sandstelle. An dieser Stelle laufen die beiden Fahrspuren der Asphaltstraße in einer Pistenspur zusammen. Daher sind die Spurrillen dort sehr tief. Ich merke, wie der Wagen heftig zu kämpfen beginnt, wundere mich und bremse. Schalte die Untersetzung zu und gebe Gas. Und deutlich mehr Gas. Dann drehen die Räder durch und der Wagen bewegt sich keinen Millimeter. Das Auto sitzt fest. Ich steige aus und begutachte die Situation. Der Wagen sitzt unten bereits komplett auf Sand auf, und die Räder sind schon zur Hälfte im Sand eingegraben. Verdammt. Also Schaufel her und los geht's, die Räder wieder frei machen.

Was ist da schief gelaufen? Ich habe den Reifendruck nicht rechtzeitig von 2.8 bar auf 2.0 bar oder darunter reduziert, wodurch die Auflagefläche der Reifen im Vergleich zum hohen Gewicht des Autos zu klein war. Es ist Mittag, der Sand ist heiß und fluide und daher wenig tragfähig. Und im tiefen Sand sollte man lieber nicht bremsen, sondern den Wagen einfach ausrollen lassen. Das Bremsen erzeugt einen Sandhügel vor den Reifen, der nur hinderlich ist. Und ein Durchdrehen der Räder muss man sowieso unbedingt vermeiden, da dies den Wagen nur unnötig eingräbt.
Ich schaufle also zunächst die Vorderräder frei und unternehme einen Befreiungsversuch. Aber da geht noch immer nichts. Also schaufle ich weiter. In dem Moment kommt ein Abschleppwagen und kämpft sich mit sehr hoher Drehzahl an mir vorbei. Die beiden Insassen fragen, ob ich Hilfe brauche. Trotz verletztem Stolz bejahe ich. Wir nutzen ein Abschleppseil, aber der andere Wagen hat viel zu wenig Kraft, mein schweres und tief im Sand festsitzendes Auto frei zu bekommen. Er selbst gräbt sich ein stückweit im Sand ein. Daher unterbrechen wir den Versuch sehr bald. Leider sind keine ausreichend stabilen Bäume in der Nähe. Aber hier zeigt sich auch, weswegen die Seilwinden zur Selbstrettung so großzügig dimensioniert sein müssen. Denn die müssen im Notfall nicht nur das Wagengewicht befördern können, sondern zusätzlich die enorme Reibung im Sand stemmen, da geht es oft genug um die gesamte Fläche des Unterbodens.

Also zurück zum Schaufeln. Einer der beiden Helfer frägt mich nach einer Axt und holt damit zwei Büsche aus dem Dickicht. Wir montieren den schweren Hilift Jack Wagenheber zunächst an der Fahrzeugfront und heben den Wagen gut einen halben Meter an. Das ist echte Schwerstarbeit, und wir müssen das zu zweit machen. Ich schwitze und merke wie mir bei jedem Hub die Kräfte schwinden. Da der Jack im Sand versinken würde, nutzen wir die Schaufel als Standfläche für den Jack. Dann graben wir mit den Händen die Vorderräder komplett frei und bringen jeweils zwei sehr großen Äste unter jeden der Reifen. Beim vorsichtigen Absenken des Wagens klemmt einer der beiden Haltebolzen am Jack. Das ist gar nicht gut, denn der Wagenheber kann aufgrund der Hebelwirkung mit der Automasse ganz leicht zur tödlichen Gefahr werden. Während der gesamten Reise war der Wagenheber am Dach montiert und hat entsprechend jede Menge Staub abbekommen. Daher verkeilt der Bolzen bei jeder Bewegung etwas. Mit einem großen Schraubenzieher kann ich vorsichtig nachhelfen und den Bolzen immer wieder in die richtige Position schieben.

Dann heben wir den Wagen von hinten an. Das erfordert noch mehr Kraft. Mein Wagenheber biegt sich sehr stark unter der enormen Last. In der Zwischenzeit sind zwei weitere Wagen angekommen. Ein schaulustiges Touristenpärchen, denen bei Einfahrt in den Park gestern das gleiche passiert ist. Und ein Ranger, der schnell einen zweiten Hilift Jack bringt und das Auto von hinten zusätzlich abstützt. So verteilt sich die Last auf beide Wagenheber. Auch die Hinterräder graben wir frei und verbringen Äste und Zweige darunter. Dann entfernen wir die Wagenheber wieder vorsichtig. Einer der Äste zerbricht lautstark unter dem Gewicht der Reifen. Dann der nächste Befreiungsversuch. Aber zunächst müssen wir noch warten, bis die beiden entgegen gekommenen Fahrzeuge aus dem Weg geschafft sind. Und dann geht es los. Mit Untersetzungsgetriebe und gesperrtem Zentraldifferential. Die Elektronik ist abgeschaltet. Anfahren im zweiten Gang. Der Motor brummt kraftvoll auf. Ein herrlicher Sound. Die Zweige knacken. Dann schaltet sich einer der Turbolader zu. Die Räder haben dank der Äste gute Traktion. Und so kann der Wagen das volle Drehmoment ausnutzen, ausreichend beschleunigen und selbständig aus dem tiefen, etwa 200 m langen Sandstück herausfahren. Es ist geschafft. Aber die Anspannung bleibt noch.

Ich entlohne die beiden Helfer und lasse dann gleich die Reifen auf 2.0 bar (im warmen Zustand) ab. Das sollten sie trotz des Gewichts des Autos aushalten. Ich verstaue die Werkzeuge vorübergehend im Auto und mache mich auf die Weiterfahrt. Der Weg bis zum North Gate ist großteils stark zerfurchter Sand, weiß und rot. Er führt durch relativ dichtes Buschwerk. Mit deutlich mehr Gas als sonst und entsprechend höherer Drehzahl und mehr Schwung meistert der Wagen auch die schwierigen Stellen. Dennoch habe ich die ganze Strecke über irgendwie ein beklemmendes Gefühl. Gar nicht so sehr, weil man recht schnell sehr tief feststecken kann, sondern weil mir - ehrlich gesagt - bewusst geworden ist, wie unglaublich anstrengend die Befreiungs- und Ausgrabungsarbeiten sind, und ich nicht weiß, ob ich das kräftemäßig auch alleine geschafft hätte. Das verunsichert mich. Zumal einige viel einsamere Strecken und Regionen vor mir liegen.

Die Formalitäten am Gate sind schnell geschafft, und die Parkgebühr von 850 Pula bezahlt. Der Ranger zeigt mir auf der Karte den zu nehmenden Weg zum Camp. Es seien noch 40 km, in gut zwei Stunden machbar. Ich frage ihn, ob ich bei der Weiterfahrt in zwei Tagen auch die direkte Verbindungspiste zwischen Linyanti und Savuti fahren könne. Davon rät er mir dringend ab. Die Strecke sei nicht gepflegt und habe zwei sehr schwere Sandstellen. Wenn ich alleine dort hängen bleibe, dann müsse ich wahrscheinlich mehrere Tage in der Wildnis überleben, bevor Hilfe kommen würde. Und die Dichte an Raubtieren sei dort derzeit recht hoch. Das ist natürlich nicht das, was ich hören wollte.

Die Weiterfahrt um kurz nach drei Uhr nach Linyanti gestaltet sich dann wieder als richtiges Abenteuer. Die Route verlangt viel fahrtechnisches Geschick. Denn der Sand ist über weite Strecken sehr tief und fein. Die Piste ist sehr stark zerfurcht, und es ist kaum zu erkennen, welche Spur bis zum Ende der jeweiligen Sandstelle die beste ist. Ein Wechsel zwischen der Spuren ist wegen deren Tiefe schwierig, und man riskiert einen starken Bremseffekt. Manchmal sitzt der Wagen trotz seiner enormen Bodenfreiheit auf dem Bulk auf. Der Sand bremst den Wagen sehr stark ab, und ich fahre wieder mit höherer Drehzahl. Die Route befindet sich in einem Wildschutzgebiet. Aber zum Suchen nach Tieren komme ich hier nicht. Ein Treffen mit einem Elefanten in einem dieser tiefen Sandstücke wäre unangenehm. Elefanten reagieren sehr sensibel auf Geräusche. Die Sandpiste wird immer herausfordernder. Zum Teil sind im Sand dicke Äste und Zweige vergraben - eventuell Überreste von fremden Befreiungsversuchen. Die krachen und knacken verängstigend. Zum Teil sind sie senkrecht im Sand vergraben und stehen nur einige Zentimeter über die Oberfläche heraus. Solche harten Äste von toten Mopanebäumen können leider einen Reifen ziemlich beschädigen. Einer dieser Äste verkeilt sich beim Drüberfahren, zerbricht mit vielen Splittern und verbiegt mir letztlich mein linkes Trittbrett.

Die Strecke erfordert sehr viel Konzentration. Dann sehe ich vor mir einen Elefantenbullen über die Piste laufen. Zum Glück bin ich gerade an einer etwas festeren Stelle und kann stehen bleiben. Tut dem Motor auch ganz gut, so bekommt er mal eine kurze Verschnaufpause. Ich warte, bis der Elefant nicht mehr sichtbar ist und noch ein paar Minuten länger. Dann fahre ich vorsichtig an der Stelle vorbei, aber der Elefant ist bereits außer Sicht. Es geht weiter. Der Weg wird jetzt immer häufiger von sichtbaren Senken durchzogen. Diese erscheinen sehr viel dunkler, auch wenn das Material selbst eher hell ist. Eventuell die lehmigen Überreste von ausgetrockneten Bachläufen. Wenn der hart gewordene Lehm in diesen ehemaligen Tümpeln von Tieren durchwandert wird, wird er feinst gemahlen und bildet extremste Staubstellen. Bei der Durchfahrt erzeugt es eine kaum zu beschreibende Staubfahne. Nicht nur direkt hinter dem Wagen, sondern auch daneben. Beim Blick in den Rückspiegel sieht man immer eine plötzlich emporschießende helle Wand. Dann fließt der Staub regelrecht wie Wasser von der Heckscheibe. Ich schließe die Fenster und schalte, trotz der hohen Innentemperatur, auf Umluftbetrieb. Der sehr feine Staub dringt trotzdem durch jede noch so kleine Ritze ins Auto ein. Das Material ist sehr unangenehm zu befahren, und so bin ich froh, dass es immer nur kurze Strecken sind. Das Auto reagiert im Staub ganz anders. Der Wagen scheint darauf zu rutschen und bricht manchmal seitlich weg. Hin und wieder bricht er in eine Vertiefung ein, ohne das ich vorher irgendwas hätte erkennen können. Diese Löcher im Boden stammen zum Teil von Warzenschweinen. Trotz aller Widrigkeiten komme ich vernünftig voran.
Um kurz nach halb fünf Uhr erreiche ich das Camp und bekomme Platz RSV02 (anstatt CL01) ganz am Fluss. Ein wunderbarer Platz. Es ist nur ein anderer Campingplatz belegt. Ich habe gerade noch Zeit die Werkzeuge wieder ordentlich zu verstauen, das Auto etwas aufzuräumen und das Zelt aufzustellen. Da beginnt schon der Sonnenuntergang. Die Seeadler sind sehr aktiv und schreien sich gegenseitig zu. Das größere Weibchen hat dabei den tieferen Ruf und das kleinere Männchen den höheren. Es sind eine Menge Flusspferde in der Gegend. Wobei ich nur drei davon sehe, die meisten machen sich nur durch ihr Grunzen bemerkbar. Das Ufer auf der Seite von Botswana ist Naturschutzgebiet und von Namibia ist Farmland. Da der Fluss nicht, wie bei uns, begradigt ist, hat er eine enorme Breite. Ganz in der Ferne, schon auf der namibischen Seite, erkenne ich eine Herde Impalas, die sich ganz vorsichtig dem Fluss nähern. Denn die Krokodile im Fluss sind immer aufmerksam. Eine Menge Vögel nutzt die sinkenden Temperaturen und fliegt den Fluss mehrfach entlang.

Ich habe das Auto mit der Motorhaube Richtung Fluss so aufgestellt, dass die Leiter des ausgeklappten Dachzelts nur unweit meines großen Baums steht, so dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Tiere die Leiter umrennen. Auf diese Weise zeigt das große Seitenfenster des Zelts direkt Richtung Fluss. Ein Gang zu den Waschräumen darf nach Einbruch der Dunkelheit nur mit dem Auto erfolgen. Das ist natürlich angesichts des schon aufgestellten Zelts eher blöd. Daher bin ich schon recht früh bettfertig. Und aufgrund der vielen Moskitos und Fliegen, die hier am Fluss auftauchen, sobald abends die Temperatur abzunehmen beginnt, ziehe ich mich bald ins insektenfreie Zelt zurück. So kann ich von dort noch die letzten Momente der Abenddämmerung miterleben. Aber spätestens um sieben Uhr bin ich vollkommen erschöpft eingeschlafen.

Die ganze Nacht über machen die Frösche einen lautstarken Radau. Das müssen wahre Riesen sein. Aber auch die Flusspferde grunzen bis tief in die Nacht. Einige Tiere besuchen das Camp. Immer wieder gibt es Rascheln, knackende Äste oder Tierlaute und natürlich eine große Anzahl von Fußspuren am nächsten Morgen.
Montag, 02. August 2021
Die Nacht war nicht sehr kalt. Es ist früher Morgen im Camp Linyanti, und ich laufe den relativ langen Weg zu den "Waschräumen". Es knackt und raschelt überall im Gebüsch neben mir. Ich komme mir vor wie ein einsamer Frühstückssnack für die Raubtiere. Ich entdecke Spuren von Hippos, die zur Grasfläche hinter dem Camp gelaufen sind, von Hyänen und Eichhörnchen. Außerdem viele Vogelspuren von diverser Größe. Leider kann ich den zeitlichen Verlauf hinter den Spuren noch nicht erkennen und so die "Buschzeitung" noch nicht wirklich lesen. Es geht ein leichter Wind, und die Windböen tragen Tiergerüche herüber. Diese Gerüche kennt man aus dem Zoo. Vom Elefanten- und vom Raubtierhaus. Auch hier sind sie genauso intensiv. Aber ich entdecke, dass die hiesigen Gerüche nicht von Tieren, sondern von blühenden Büschen stammen. Erleichterung macht sich breit.

Heute ist Ruhetag im Camp Linyanti. Ich sitze im Campingstuhl vor meinem Auto. Circa 50 m vor mir bewegen sich zwei Hippos im Wasser. Im Laufe des Tages werden immer wieder Flusspferde vorbeikommen und Wasserpflanzen fressen. Im hohen Baum links neben mir sitzt ein Schreiseeadlerpärchen und schreit.
Der große Baum auf meinem Platz ist ein Kameldorn und besteht aus vier Stämmen. Einer der Stämme ist fast ausgehöhlt. Der Baum spendet angenehmen Schatten. Es geht ein leichter Wind. Der quält die Insekten und hält deren Zahl gering. Zum Glück werden auch die Moskitos weniger, sobald es warm wird. Aber die lästigen und penetranten Fliegen bleiben den ganzen Tag. Plötzlich fliegt ein erschreckend großes Insekt mit beängstigendem Brummen vorbei.

Der Fluss fließt westwärts Richtung Okawango Delta aber nur sehr langsam. Die Wasseroberfläche ist überwiegend ruhig und glatt. Im Wasser sieht man aber isolierte raue Stellen, in denen der Wind stark zu wehen scheint. Einmal kurz vor Mittag fegt ein Luftwirbel von Land kommend über das Wasser. Er ist nur anhand der kreisförmigen und rasend schnellen Oberflächenbewegung des Wassers zu erkennen. Um als Wind-, Sand- oder Wasserhose zu erscheinen, ist er wohl zu schwach. Dann ist das Wasser wieder still und die Oberfläche ganz glatt. Wenn der Wind mal von der Flussseite kommt, dann riecht es recht deutlich nach Brackwasser und vermodernden Pflanzenresten.

Hin und wieder raschelt es im Gebüsch. Es sind Vögel. Meistens die gleichen zwei. Sie suchen dort im Unterholz nach Insekten und Samen. Einige der hiesigen Vögel twitschern gar nicht, sondern geben ganz unterschiedliche Laute von sich, zum Beispiel Glucken, Brummen oder Krächzen. Wenn ich ganz ruhig da sitze, kommt immer mal wieder ein gelb-roter Specht vorbei und hüpft auf dem Auto herum. Dort pickt er Insekten vom Scheibenwischer. Später am Nachmittag hängt er kopfüber an einem dicken Ast und klopft ausdauernd daran herum. Zwei metallisch, blau glänzende Riesenglanzstare sind den ganzen Tag hier, kommen sehr nahe und suchen auf dem Platz ständig nach Futter. Auch einige Gelbschnabeltokos sind vor Ort und recht wenig ängstlich oder einfach nur neugierig.

Am frühen Nachmittag besucht mich ganz vorsichtig ein Eichhörnchen. Es klettert vom großen Baum herunter und geht auf Futtersuche in der Umgebung. Es ist leider sehr schreckhaft. Aber dann entdecke ich noch zwei im Baum. Etwas später sitzen sie zusammen unten an einem der vier Baumstämme und geben eindeutig Warnrufe aus. Irgendwie kommt mir das komisch vor, und ich schaue genauer nach. Tatsächlich, da macht sich ein großer Waran daran, auf den Baum zu klettern. Als ich näher komme, macht er sich allerdings davon, und die Eichhörnchen beruhigen sich wieder.




Dienstag, 03. August 2021
Ich hadere lange mit mir, ob ich die schwierige Direktstrecke nicht doch wagen sollte. Auf meiner Reise waren die Auskünfte der Ranger bisher eher wenig zuverlässig. Im schlimmsten Fall muss ich das Satelliten SOS meines inReach GPS gebrauchen und mir teure Hilfe organisieren, und werde dann halt einige Tage im Nichts ausharren müssen. Aber ist es das wirklich wert? Ich entscheide mich dagegen.
Die Mitarbeiterin des Camps, die mich am Sonntag um eine Mitfahrgelegenheit nach Savuti gebeten hat, wird nun doch nicht mit mir fahren, da sie später von einem Lieferlastwagen mitgenommen wird. Ich fahre zum Gate von Linyanti. Dort wird mir empfohlen, nicht die Piste vom Sonntag zu nehmen, sondern die etwa 50 Meter nördlich davon, parallel verlaufende Spur. Die sei nicht ganz so sandig. Das mit dem sandig kann ich nicht bestätigen, aber sie hat fast durchgehend Sand und nirgendwo Staub. Auch das ist schon sehr viel angenehmer zu fahren.

Ich habe etwa die halbe Strecke geschafft, da umfährt die Piste ein Wasserloch. Kaum wieder auf der ursprünglichen Spur, steht in circa 30 m Entfernung ein halber Elefant auf der Fahrspur. Der Kopf ist irgendwo im Gebüsch, und nur das Hinterteil ist zu sehen. Ich nähere mich langsam, und da stapft der Dickhäuter auf die Piste und gibt die eindeutige und typische Drohgebärde. Ich fahre langsam etwas zurück. Die Drohung hört auf, und der Elefant schaut fast regungslos in meine Richtung. Dann springt ganz unverhofft vor dem Elefanten ein kleines Elefantenbaby fidel über die Piste und verschwindet, bevor ich nur daran denken konnte, nach dem Fotoapparat zu greifen. Na, damit wird die Nervosität der Mutter verständlich. Ich bleibe in gebührendem Abstand, und die Mutter macht sich wieder ans Fressen. Dann kreuzen mehrere Elefanten den Weg und verschwinden auf der anderen Seite im Gebüsch. Kurz darauf laufen wieder Elefanten über die Piste, aber in die andere Richtung. Dann hopst das Elefantenbaby wieder über den Weg und die Mutter hinterher.

Ich bin mir über die Anzahl an Elefanten nicht sicher und auch nicht, in welche Richtung sie eigentlich gehen möchten. Ich hoffe, dass sie nicht zum Wasserloch wollen, das direkt hinter mir liegt. Daher schleiche ich langsam rückwärts bis zur Umfahrung des Wasserlochs zurück und fahre dann 30 m durch das Buschwerk auf die parallel verlaufende Hauptstraße, die ich gestern gefahren bin. Kaum habe ich beschleunigt, steht da schon wieder ein Elefant. Eventuell gehört er auch zu dieser Familie. Jedenfalls bleibe ich wieder stehen und warte. Zwei große Elefanten überqueren die Piste, aber der dritte steht noch immer am Wegrand. Dann kommen drei weitere Tiere und jener dritte schließt sich ihnen an. Alle vier verschwinden schnell im Busch der gegenüberliegenden Seite. Ich fahre langsam los. Kann aber nirgendwo mehr einen Elefanten ausmachen. Dann geht's ohne weiteren Halt zum Ghoha North Gate.

Von dort fahre ich zunächst direkt nach Savuti, diesmal über die Airstrip Route. Mehrmals sehe ich Elefantenfamilien und jedesmal mit Babys. Das macht die Erwachsenen, genau genommen die Mütter, ziemlich aggressiv. Ich halte daher sehr viel Abstand. Aber alleine tue ich mich dann doch schwer, sie alle im Busch zu entdecken. Ich möchte nicht, dass plötzlich ein Dickhäuter von hinten kommt oder mir irgendwo den Rückzugsweg abschneidet.

Heute sind auch schwierige Sandstrecken kein Problem. Ob es daran liegt, dass ich wieder Zutrauen gefasst habe, die Strecken hier einen kleinen Tick häufig befahren und damit besser verdichtet sind oder weil es hier überwiegend Sand und kein Staub ist, kann ich nicht sagen. Aber das Fahren macht wieder richtig Spaß.

Ich unterhalte mich mit einem Ranger über einige meiner Beobachtungen. Und da macht er mich auf eine interessante Tatsache aufmerksam. Das Kurzzeitgedächtnis von Tieren ist wirklich sehr kurz. Und die Aufmerksamkeitsspanne liegt auch nur bei wenigen Sekunden. Wenn also eine Gefahr, zum Beispiel eine Raubkatze, aus dem Blickfeld gerät, ist sie von den Beutetieren bereits nach Sekunden schon wieder vergessen.

Im Camp belege ich Platz CV6. Er ist am weitesten entfernt und am einsamsten. Es ist sowieso nicht sehr viel los. Eine Gruppe lärmender Jugendlicher im Bodenzelt und ein Ehepaar mit Dachzelt. Ich stehe unter einem alten Kameldornbaum. Hier gibt es kein künstliches Licht. Der Sternenhimmel und die Milchstraße sind hervorragend zu erkennen. Einfach wunderschön.

Mittwoch, 04. August 2021
Von heute tief in der Nacht bis in die Morgenstunden haben Löwen in der Nähe gebrüllt. Auch heute Nacht lief der Generator wieder ununterbrochen, aber ich bin soweit von ihm weg, dass ich ihn fast nicht mehr wahrnehmen konnte. Gnus und Impalas waren heute Nacht im Camp.

Beim Zusammenbauen des Zelts beobachten mich zwei freche, metallisch glänzende Stare. Auch ein Gelbschnabeltoko. Mehrere Frankolinchen laufen vorbei. Ein Erdhörchen bleibt kurz auf der offenen Fläche stehen und läuft dann aber leider weiter. Aus einem der dichten Büsche kommt wenig später eine Zebramanguste und schimpft laut. Leider nur, bis ich die Kamera geholt habe.

Ich fahre heute eine große Runde um das Camp zunächst Richtung Norden. Ich sehe eine Giraffen-Familie mit sieben Mitgliedern. Sie fressen an grünen Büschen in der Nähe eines Wasserlochs. Weil viele der Familienangehörigen gleichzeitig an einem Busch fressen, sieht es nach einem gemeinschaftlichen / kollektiven "Z'amfressen" aus. Eine Impala-Herde ist ganz in der Nähe. Sie stehen relativ dicht gedrängt im Schatten eines Busches. Viele in Habachtstellung. Erst als die Giraffen nach einer guten halben Stunde abziehen, wagen sich die Impalas ganz langsam zum Wasserloch. Zuerst nur die jungen Tiere. Die Alten stehen besorgt weiterhin in ihrer unbequemen Stellung, allerdings inzwischen in der prallen Sonne. Nun gut, es hat nur 24 °C, aber die Sonne brennt dennoch. Dann werden die Impalas für kurze Zeit von zwei Warzenschweinen gestört, die von der anderen Seite zum Trinken ans Wasser gekommen sind. Sie wälzen sich nun genüsslich im Schlamm. Aber es dauert nicht lange, bis die Impalas weiter heran trotten und sich von den Warzenschweinen nicht stören lassen.



Ich stelle mich an den nördlichen Stretch Point in den Schatten eines alten Baumes und beobachte die Gegend. Die Gedanken schweifen ab. Nachdem die Sonne sich doch um einiges weiterbewegt hat, steht der halbe Wagen in der prallen Sonne. Ich fahre also weiter zu verschiedenen Wasserlöchern und Hügeln in der Nähe, sehe aber außer ein paar Impalas und vielen Vögeln keine anderen Tiere.
Etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang stelle ich mich wieder in den Schatten eines Baumes an einem Wasserloch und beobachte, was da so alles zum Trinken kommt. Bienenfresser vollführen irre Flugmanöver und fangen dabei Insekten. Sie landen immer wieder auf den selben Zweigen. Der Versuch das aufzunehmen, misslingt hartnäckig. Dann schleicht ein kleiner Marder unvermittelt aus dem Schatten ans Wasser und verschwindet alsbald wieder. Perlhühner, Gelbschnabeltokos, Silverstarlings, Frankolinchen. Zwei Ibisse. Einige taubenähnliche Vögel. Im Hintergrund zwei Impalas.


Dann fahre ich noch eine Runde durch eine der Geländesenken. Alles goldgelbes Gras, das in der Abendsonne so toll aussieht. Dort sehe ich nochmal Zebras und Gnus. Unweit des letzten Wasserlochs genieße ich den Sonnenuntergang mitten in der Grassteppe.


Donnerstag, 05. August 2021
Der blöde Ranger am Camp hat mir empfohlen, die Marsh Road zum Mababe Gate zu nehmen, da ich die Sandrigde Road schon gefahren bin. Die Marsh Road ist lehmig, staubt fürchterlich an den Stellen, wo der Lehm von den Tieren zertrampelt wurde, ist viel länger und wegen des oft harten Lehms unangenehm zu fahren. Es poltert und rumpelt. Dann kommt ein Ranger mit Touristen im Safariauto vorbei und meint, auf dieser Straße liegen rechts ein paar Löwen. Nicht weit. Ich fahre und tatsächlich nach circa einem Kilometer liegen sie da. Ich bin der einzige Beobachter. Die Löwen lassen sich nicht stören. Vor allem nicht die neugierigen Kleinen. Ich sehe zwei Löwenweibchen mit zwei kleinen Löwenjungen. Aber wie so oft bei Löwen, liegen sie vornehmlich faul in der Gegend herum. Bis ein Konvoi von drei Autos anrollt und die Ruhe komplett stört. Woraufhin sich die Löwen sehr schnell in den tiefen Busch verziehen.

Die Fahrt ist weiterhin nicht angenehm. Der steinharte Lehmboden fordert die Dämpfer ordentlich heraus. Die Vegetation besteht in der ersten Hälfte aus Buschwerk, zum Teil aus Dornbüschen mit zentimeterlangen, harten Dornen. Die bilden eine echte Gefahr für die Reifen. Außerdem ist der Busch stellenweise sehr dicht und bis ganz an die Piste heran, so dass die Äste, Zweige und Dornen beiderseits am Auto entlang kratzen, mit diesem fiesen Quietschton. Daran merkt man, dass die Strecke in letzter Zeit wenig befahren worden ist. In der zweiten Hälfte geht die Vegetation in große, ausgetrocknete Grasebenen über. An einigen Stellen - ich glaube, das sind Tierwanderwege - ist der Lehm zu Staub zerfallen und das erzeugt hinter, unter, neben und sogar vor dem Auto eine Staubexplosion, dass ich freiwillig die FFP2 Maske trage. Die Außentemperatur beträgt 31 °C. Im Fahrzeug wird es wegen der geschlossenen Fenster und des Umluftbetriebs ungemütlich heiß.

Ich sehe wirklich sehr viele Vögel, zwei Warzenschweine, eine Gruppe Gnus. Immer wieder Zebras und Impalas. Und eine sehr große Gruppe Giraffen. Dreimal treffe ich auf Elefanten. Es sind einsame große Bullen, die in meinem Auto keine Gefahr sehen und sehr gelassen reagieren. Nicht wie die männlichen Teenager oder Muttertiere mit Babys, die relativ nervös sind und schnell Drohgebärden machen.
Dann verlasse ich den Park am Mababe Gate, und der dortige Ranger meint, es sind immer noch 3 Stunden Fahrt. Das muss bedeuten, dass es sich um eine Holperpiste handelt. Und tatsächlich die nächsten 2 1/2 Stunden werde ich entsetzlich durchgeschüttelt. Es fängt mich immer mehr an zu nerven. Vor allem nach der langen Fahrt wünsche ich mir endlich Ruhe. Ich glaube die Stoßdämpfer sind jetzt etwas zu weich eingestellt, sie federn zu sehr nach. Als ich endlich die Teerstraße erreiche, bin ich völlig fertig und durchgeschüttelt. Und am Dachträger ist irgendwas locker geworden. Da scheppert es unentwegt.

Schließlich fahre ich nach Maun hinein. Auf der Straße joggen ein paar Weiße. Leider hat die Firma SKL bereits geschlossen, so dass ich das auf morgen verschieben muss. Ich fahre über den Fluss und in den großen Kreisverkehr (in Maun gibt es genau einen) hinein, da sehe ich das einstöckige Verwaltungsgebäude des Wildlife Ministeriums. Auch das brauche ich morgen. Ich komme zum Sonnenuntergang in der Unterkunft an. Sie hat recht gehobenen Standard und ist neu gebaut, wenngleich natürlich auf afrikanischem Niveau. Und sie ist sehr sauber. Wie oft in Afrika, sind zum Beispiel die Sanitäreinrichtungen nicht professionell und nicht haltbar ausgeführt. Mehrere Fliesen am Boden sind gesprungen, weil der Untergrund nicht gut präpariert wurde. Die Toilette ist nicht mit dem öffentlichen Abwassernetz verbunden, wenn es so etwas in Maun überhaupt gibt, sondern entsorgt in eine Sickergrube. Die Duschabtrennung hat ein Loch, wahrscheinlich aus der Bauzeit, das mit Klebeband ausgebessert wurde. Das Waschbecken ist auf einem Metallgestell montiert und wackelt heftig, während der Wasserhahn ebenfalls nicht fest ist, sondern sich frei drehen und herausziehen lässt. Aber immerhin gibt es Wasser und das kalt und warm.
| Vorhergehender Beitrag | Übersicht | Nächster Beitrag |